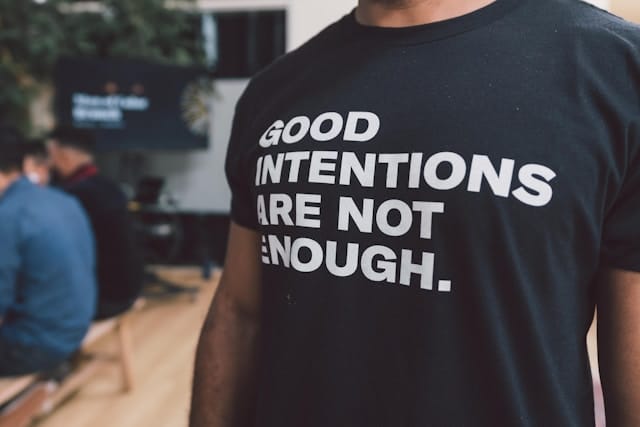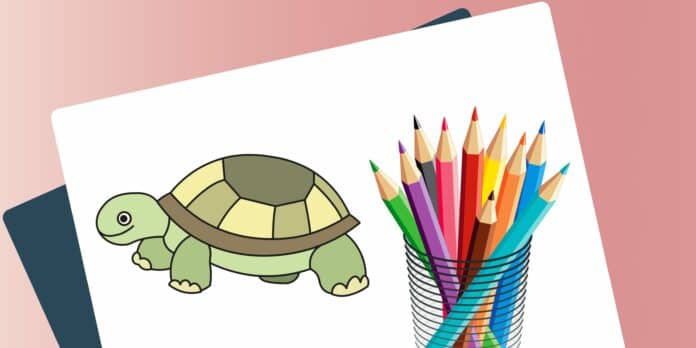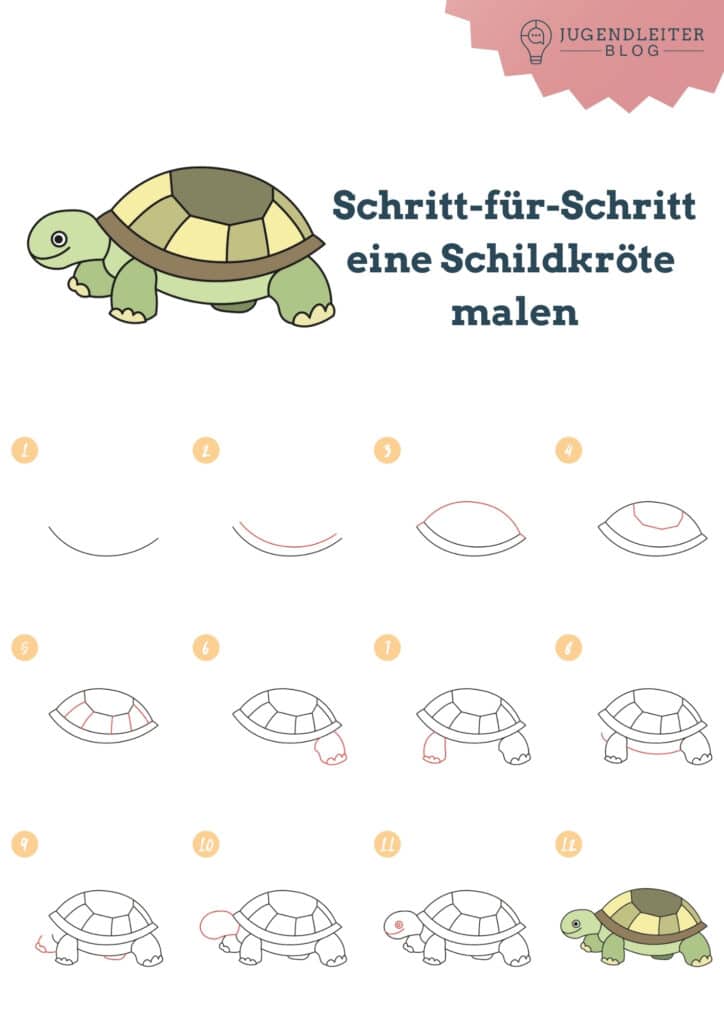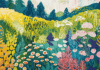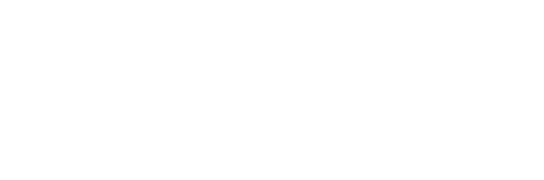Sucht ihr nach unterhaltsamen und spannenden Aktivitäten für eure nächste Jugendveranstaltung? Dann seid ihr hier genau richtig! In diesem Artikel präsentiere ich euch eine Sammlung von kreativen 1-Minuten-Spielen, die nicht nur den Teamgeist fördern, sondern auch für viel Spaß und Lachen sorgen. Diese Spiele sind ideal für verschiedene Anlässe wie Gruppenstunden, Freizeiten oder Feste und erfordern nur wenig Material und Vorbereitung. Egal, ob drinnen oder draußen, diese Spiele sind leicht umsetzbar und garantieren ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten. Lasst euch inspirieren und bringt frischen Wind in eure Jugendarbeit!
Merk ich mir!
Material: Post-It-Notizen
So geht’s: Lasst die Spieler*innen versuchen, innerhalb von 60 Sekunden die meisten Post-It-Notizen auf ihr Gesicht zu kleben (ohne dass sie herunterfallen). Die Person mit den meisten Notizen gewinnt.
Keks-Gesicht
Material: Kekse
So geht’s: Platziert einen Keks auf der Stirn der Spieler*innen. Sie haben 60 Sekunden Zeit, um den Keks nur mit dem Gesicht in den Mund zu bekommen. Hände zu benutzen ist nicht erlaubt.
Löffeln
Material: Wattebausch, Teller, Plastiklöffel, Augenbinde
So geht’s: Die Spieler*innen verwenden einen Plastiklöffel, um die Wattebausch von einem Teller auf einen anderen zu bewegen, während sie blind gefaltet sind. Wer innerhalb von 60 Sekunden die meisten schaufelt, gewinnt.
8 Treffer
Material: Becher und Tischtennisbälle
So geht’s: Die Spieler*innen müssen Tischtennisbälle in 8 Becher innerhalb von 60 Sekunden werfen.
Tüten beißen
Material: Papiertüten
So geht’s: Die Spieler*innen müssen 5 Papiertüten mit unterschiedlicher Höhe nur mit den Zähnen aufheben und auf einen Tisch abstellen.
Orangen-Transport
Material: Orangen
So geht’s: Bildet gleichmäßige Teams und stellt euch in einer Reihe auf. Die Orange darf nur von Kinn und Nacken berührt werden – Hände sind nicht erlaubt! Wenn die Orange fällt, fangt in der Reihe von vorne an. Das erste Team, das die Orange an die letzte Person in der Reihe weitergibt, gewinnt.
Süßes vor dem Mund
Material: Holzstäbchen und Süßigkeiten
So geht’s: Balanciert Süßigkeiten auf einem Holzstäbchen, das im Mund der Spieler*innen gehalten wird. Beginnt mit nur dem Stab im Mund und fügt nacheinander Süßigkeiten hinzu.
___STEADY_PAYWALL___
Der Hüftschwung
Material: Leere Taschentuchbox, Klebeband und Tischtennisbälle
So geht’s: Befestigt eine leere Taschentuchbox mit Klebeband am Gesäß der Spieler*innen. Platziert 8 Tischtennisbälle in der Taschentuchbox, und die Spieler*innen müssen alle innerhalb von 60 Sekunden heraus shaken.
Gegen die Schwerkraft
Material: Luftballons
So geht’s: Gebt den Spieler*innen 3 Luftballons. Sie müssen alle Ballons eine Minute lang in der Luft halten.
Stäbchen-Spiel
Material: Essstäbchen, Schüssel, Müsli
So geht’s: Die Spieler*innen übertragen so viele Müslistücke wie möglich von einer Schüssel in eine andere nur mit Essstäbchen. Der Spieler bzw. die Spielerin, der/die die meisten überträgt, gewinnt.
Wasser marsch
Material: Sprühflasche, Ballon und Mülleimer
So geht’s: Die Spieler*innen erhalten eine Sprühflasche mit Wasser und müssen einen Ballon (in der Luft) in einen Mülleimer leiten. Wenn der Ballon auf den Boden fällt, müssen sie zum Start zurück.
Süßes werfen
Material: Marshmallows und Becher
So geht’s: Es werden Teams gebildet. Gebt den Spieler*innen Marshmallows. Alle werfen abwechselnd Marshmallows in einen Becher für 60 Sekunden. Das Team mit den meisten Marshmallows im Becher gewinnt.
Bonbons auspacken
Material: Mehrere Packungen Bonbons
So geht’s: Die Spieler*innen treten gegeneinander an und versuchen, in einer Minute die meisten Bonbons auszupacken.
Floßbau
Material: Eine Wanne, ein Plastikteller, leere Getränkedosen
So geht’s: Die Wanne wird zu 3/4 mit Wasser gefüllt. Die Spieler*innen müssen den Plastikteller so platzieren, dass er auf dem Wasser schwimmt. Dann müssen sie darauf die Getränkedosen aufeinander stapeln, ohne dass sie umfallen oder der Teller umkippt. Wer dies in unter einer Minute erfolgreich abschließt, gewinnt.
Oreo-Balance
Material: Oreo-Kekse und Plastikgabeln
So geht’s: Die Spieler*innen balancieren einen Oreo auf einer Gabel und gehen innerhalb von 60 Sekunden zu einem bestimmten Punkt und zurück, ohne den Oreo fallen zu lassen. Es gewinnt, wer den Oreo am häufigsten hin und her trägt, ohne ihn fallen zu lassen. Wenn der Oreo während der Minute herunterfällt, wird die Zählung zurückgesetzt.
Wandernde Münze
Material: Strumpfhose und Münzen
So geht’s: Legt eine Münze in den Fuß von jeder Strumpfhose. Die Spieler müssen die Strumpfhose anziehen und versuchen, die Münze innerhalb einer Minute nach oben zu bewegen, bis sie zu ihrer Taille gelangt.
Turmbau
Material: Plastikbecher
So geht’s: Die Spieler*innen treten gegen die Uhr an, um den höchsten Turm aus 36 Plastikbechern innerhalb einer Minute zu bauen.
Süße Nase
Material: Süßkartoffel
So geht’s: Schiebt eine Süßkartoffel nur mit der Nase so oft es innerhalb von einer Minute geht von einer Seite des Raumes zur anderen.
Durch den Flaschenhals
Material: 2-Liter-Flaschen und Müsli
So geht’s: Füllt eine 2-Liter-Flasche mit Müsli und klebt sie an eine andere 2-Liter-Flasche. Die Spieler*innen müssen alles innerhalb von 60 Sekunden von einer Flasche in die andere schütteln.
Mumienattacke
Material: Toilettenpapier, Papiertücher oder Streamer
So geht’s: Zwei Spieler*innen müssen mit den Materialien eine andere Person wie eine Mumie einwickeln. Die Teams haben eine Minute Zeit, um die beste Mumie zu erstellen.
Blind kegeln
Material: Ball, Augenbinde, etwas, das als Bowling-Pins dient (leere Getränkedosen oder Flaschen, Tannenzapfen, Toilettenpapierrollen, etc.)
So geht’s: Stellt Bowling-Pins auf. In 60 Sekunden können die Spieler*innen so oft wie nötig blind bowlen, bis sie alle Pins umwerfen oder die Minute abgelaufen ist.
Spitze Worte
Material: Zahnstocher und Tisch
So geht’s: Die Spieler*innen müssen mit Zahnstocher Wörter ohne Brechen oder Biegen der Zahnstocher aus eben diesen bilden. Die Person mit den meisten Wörtern nach einer Minute gewinnt.
Mini-Transport
Material: Eine Schüssel, ein Blatt Papier, Klebeband, Mini-Marshmallows und Plastikbecher
So geht’s: Stellt die Schüssel auf eine Seite des Raumes. Legt einen Becher mit Mini-Marshmallows auf die andere Seite des Raumes. Die Spieler*innen müssen ihr Papier aufrollen und zusammenkleben. so dass ein Mini-Marshmallow hineinpasst. Um das Spiel zu gewinnen, müssen die Spieler*innen auf dem Boden sitzen und die Marshmallows durch ihr aufgerolltes Papier in die Schüssel schießen. Die Person mit den meisten in der Schüssel gewinnt.
Schüttel-Schüttel
Material: 5 Boxen und 15 kleine Objekte, die in die Boxen passen
So geht’s: Füllt Boxen mit unterschiedlichen Anzahl von Objekten (1-5). Die Spieler*innen müssen die Boxen schütteln und in der Reihenfolge der Anzahl der Objekte anordnen.
Smarties kullern lassen
Material: Becher und M&Ms
So geht’s: Bevor das Spiel beginnt, stellt 10 Plastikbecher auf eine Seite des Tisches und platziert eine Schüssel M&Ms am anderen Ende. Die Spieler*innen müssen am einen Ende des Tisches stehen und die M&Ms über den Tisch rollen, um die Plastikbecher umzuwerfen. Die Person, die nach 60 Sekunden die meisten umgeworfen hat, gewinnt.
Gut angezogen
Material: Kleidungshaufen
So geht’s: In Zweier-Teams wird eine Person ausgewählt, die die andere Person anzieht, und eine, die angezogen wird. Spieler*in 1 läuft zu einem Haufen Kleidung und wählt ein Stück, um die andere Person anzuziehen. Das Kleidungsstück muss komplett an sein, bevor das nächste Stück gebracht wird. Die Person, die am Ende einer Minute „am besten gekleidet“ ist, gewinnt.
Wurm finden
Material: Schlagsahne, eine Schüssel, Gummiwürmer
So geht’s: Die Spieler*innen erhalten eine Schüssel mit Schlagsahne, in der 6 Gummiwürmer versteckt sind. Sie müssen so viele wie möglich innerhalb einer Minute nur mit dem Mund herausziehen.
Gute Nummern
Material: Eine Schüssel, Papier und Stift
So geht’s: Schreibt die Zahlen 1-50 auf kleine Zettel, faltet sie und legt sie in eine Schüssel. Lasst alle Spieler*innen zu einem Tisch laufen und die Zettel auskippen. Sie müssen die Zettel entfalten und innerhalb einer Minute in der richtigen Reihenfolge anordnen. Die Person mit den meisten in einer Reihe gewinnt.
Lass platzen
Material: Ballons und Schnur
So geht’s: Alle Spieler*innen binden sich einen Ballon an den Knöchel. Das Ziel ist es, die Ballons aller anderen Spieler*innen zu zerplatzen, während man den eigenen schützt. Die Person, die die meisten Ballons zerplatzt, gewinnt!
Abreißer!
Material: Spiralnotizbücher (kann verwendet werden)
So geht’s: Die Spieler*innen müssen ein Blatt nach dem anderen aus den Spiralnotizbüchern reißen (nicht mehr als ein Blatt auf einmal). Die Person mit den meisten gerissenen Seiten nach einer Minute gewinnt.
Wer kann einpacken?
Material: Geschenkpapier, Klebeband, Boxen
So geht’s: Lasst die Spieler*innen innerhalb von 60 Sekunden so viele Geschenkboxen wie möglich ordentlich (!) einwickeln. Die Person mit den meisten eingewickelten Boxen gewinnt.
Umwerfend!
Material: Ballon und Plastikbecher
So geht’s: Die Spieler*innen haben eine Minute Zeit, um einen Ballon aufzublasen und mit der Luft 10 Plastikbecher, die in einer Reihe angeordnet sind, umzuwerfen. Sie können diese Aufgabe so oft wiederholen, wie sie möchten. Die Person, die die meisten Becher umwirft, gewinnt.
Nudel-Schlacht
Material: Ungekochte Spaghetti, ungekochte Penne und ein Teller
So geht’s: Alle Spieler*innen stecken sich eine ungekochte Spaghetti in den Mund und versuchen, 5 ungekochte Penne-Nudeln von einem Teller damit aufzuheben. Die erste Person, die 5 Penne auf ihrer Spaghetti hat, gewinnt.