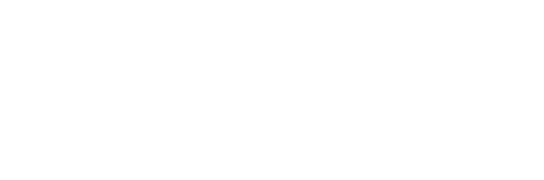Woran erkenne ich, in welcher Phase meine Gruppe gerade ist?
Die Übergänge zwischen den Phasen sind nicht immer klar erkennbar. Gruppen können auch rückfällig werden – etwa von “Performing” zurück zu “Storming”, wenn ein*e neue*r Teilnehmer*in dazukommt oder ein großer Konflikt auftritt. Es lohnt sich deshalb, regelmäßig innezuhalten und die folgenden Fragen zu stellen:
___STEADY_PAYWALL___
– Wie gehen die Teilnehmenden miteinander um?
– Gibt es offene oder unterschwellige Konflikte?
– Ist die Gruppe eher ruhig, unklar oder produktiv?
– Wie reagiert die Gruppe auf Struktur oder Freiraum?
– Welche Rolle nehme ich als Leitung gerade ein?
Diese Reflexion hilft, pädagogisch angemessen zu handeln und die Gruppe dort abzuholen, wo sie gerade steht.
Phase 1: Forming – die Gruppe findet sich
Wenn eine neue Kinder- oder Jugendgruppe zusammenkommt, beginnt ein sozialer Prozess – das sogenannte “Forming”. Diese Anfangsphase ist geprägt von Unsicherheit, Zurückhaltung und dem Bedürfnis nach Orientierung. Kinder und Jugendliche beobachten einander und versuchen, Gruppenregeln zu erkennen. Die Leitung spielt dabei eine zentrale Rolle, indem sie Sicherheit gibt und den Rahmen für die weitere Entwicklung der Gruppe schafft.
Kennzeichen der Forming-Phase
Die Forming-Phase ist die Orientierungsphase. Sie ist von einem hohen Maß an Unsicherheit geprägt. Die Teilnehmenden sind meist zurückhaltend, freundlich und abwartend. Konflikte treten kaum offen zutage, da viele noch mit ihrer eigenen Positionierung beschäftigt sind. Folgende Merkmale sind in dieser Phase typisch:
– Unklarheit über Rollen, Regeln und Gruppennormen
– freundlicher, aber oberflächlicher Umgang
– Zurückhaltung bei eigenen Meinungsäußerungen
– großes Informations- und Orientierungsbedürfnis
– hoher Einfluss der Leitungsperson
Diese Dynamiken sind vollkommen normal und ein notwendiger Teil jeder Gruppengenese. Sie zu erkennen und gezielt zu gestalten, gehört zu den Schlüsselkompetenzen von Jugendleiter*innen.
Was Gruppen jetzt brauchen: Orientierung und Sicherheit
In der Forming-Phase brauchen Kinder und Jugendliche in erster Linie eines: Klarheit. Wer ist die Leitung? Wie funktioniert diese Gruppe? Welche Regeln gelten? Was wird erwartet? Unsicherheiten können Ängste oder Rückzug auslösen, weshalb in dieser Phase ein sicherer Rahmen besonders wichtig ist. Sicherheit entsteht durch eine verlässliche Gruppenleitung, transparente Kommunikation und erkennbare Strukturen. Auch das soziale Kennenlernen spielt eine wichtige Rolle: Nur wer sich gesehen fühlt, kann Vertrauen entwickeln. Die Leitungsrolle ist in dieser Phase stark gefordert, denn die Gruppe orientiert sich an ihr. Es geht um Präsenz, Verständlichkeit und Führung, ohne zu überfordern.
Die Rolle der Leitung im Forming
Jugendleiter*innen sind in der Forming-Phase vor allem Strukturgeber*innen, Vertrauenspersonen und Impulsgeber*innen. Sie sind gefordert, einen Raum zu schaffen, in dem sich alle sicher und gesehen fühlen. Dabei gilt es, eine Balance zu finden zwischen Anleitung und Offenheit:
– klare Regeln kommunizieren, aber nicht autoritär auftreten
– Teilnehmende individuell ansprechen, ohne sie zu überfordern
– Raum für Fragen geben, ohne Unsicherheit zu verstärken
– Orientierung geben, aber Entwicklung zulassen
Leitung bedeutet in dieser Phase vor allem, präsent zu sein. Das bedeutet nicht, alles zu dominieren, sondern achtsam die Atmosphäre zu gestalten. Gruppenprozesse geschehen nicht “nebenbei” – sie sind zentral in der Jugendarbeit.
Praxistipps für die Forming-Phase
Die Gestaltung der ersten Gruppenstunden oder Programmpunkte hat großen Einfluss auf die weitere Entwicklung. Ziel ist es, eine offene, wertschätzende und sichere Gruppenatmosphäre zu schaffen. Folgende Elemente haben sich bewährt:
Kennenlernspiele
Spiele, die Namen, Interessen oder Bewegungen einbinden, helfen, erste Hürden zu überwinden. Wichtig: Kein Druck, keine Bloßstellung, keine Bewertung.
Beispiele:
– Namensball
– Steckbrief-Bingo
– Partnerinterview
Klare Regeln und Strukturen
Ein gemeinsam entwickelter Gruppenvertrag oder einfache Regeln, die offen kommuniziert und von allen mitgetragen werden, geben Halt. Auch Zeitstrukturen (Beginn, Ende, Pausen) sollten klar sein.
Transparente Kommunikation
Erklärungen, warum etwas wie abläuft, schaffen Vertrauen. Auch Hinweise, was in Zukunft geplant ist, geben Orientierung.
Aktive Beteiligung unterstützen
Bereits in der Forming-Phase werden kleine Beteiligungsmomente eingebaut. Zum Beispiel: Welche Themen interessieren euch? Was wollt ihr zusammen machen?
Beobachten und reflektieren
Nicht alles lässt sich steuern. Wer jedoch genau beobachtet, wie sich die Gruppe verhält, kann besser einschätzen, wann der Übergang in die nächste Phase beginnt.
Wer die Forming-Phase gut gestaltet, legt den Grundstein für eine konstruktive Weiterentwicklung der Gruppe. Denn Sicherheit, Vertrauen und erste gemeinsame Erfahrungen bilden die Basis für eine tragfähige Gemeinschaft.
Phase 2: Storming – Konflikte und Rollenklärung in der Gruppenentwicklung
Nach der vorsichtigen Einstiegsphase (Forming) folgt mit der Storming-Phase eine konfliktreiche Entwicklungsstufe. Individuelle Bedürfnisse und Machtfragen treten in den Vordergrund, Regeln werden hinterfragt, Spannungen entstehen. Die Gruppe klärt Rollen und testet Grenzen aus. Für die Leitung ist diese Phase herausfordernd, aber entscheidend, um den Weg zu einer funktionierenden Gemeinschaft zu ebnen.
Typische Merkmale der Storming-Phase
Die zweite Phase in Tuckmans Phasenmodell ist durch Auseinandersetzung geprägt – und das in mehrfacher Hinsicht. Die Gruppe setzt sich mit sich selbst auseinander, mit der Leitung, mit den Aufgaben und mit der Frage: “Wie wollen wir hier eigentlich zusammenarbeiten – und wer sagt das?” Das äußert sich oft in:
– Macht- und Positionskämpfen
– Cliquenbildung
– offener oder verdeckter Widerstand
– Kritik an der Leitung
– schwankende Stimmung
– erste Konflikte
Die Storming-Phase bringt all das an die Oberfläche, was bisher unterdrückt oder höflich zurückgehalten wurde – und das ist normal und notwendig.
Was Gruppen jetzt brauchen
Der Übergang von einer höflichen Anfangsgruppe zu einer echten sozialen Gemeinschaft ist kein glatter Prozess. Kinder und Jugendliche benötigen in dieser Phase vor allem:
– Sicherheit in der Auseinandersetzung
– klare Orientierung
– Gehör für ihre Perspektiven
– gelebte Fairness
– Mitgestaltung und Einfluss auf Regeln
Die Rolle der Leitung: Moderator*in statt Macher*in
Jugendleiter*innen sind in der Storming-Phase gefordert – aber nicht, um alles “geradezubiegen”, sondern um einen sicheren Rahmen für Konflikte zu schaffen. Es geht darum, Haltung zu zeigen, ohne zu dominieren, Raum zu geben, ohne sich zurückzuziehen.
Wichtige Leitungsaufgaben in dieser Phase:
– Konflikte frühzeitig erkennen und ansprechen – auch wenn sie noch unterschwellig sind
– Sanktionen vermeiden, wo Klärung durch Gespräch möglich ist.
– neutral bleiben bei Streit oder Gruppenspaltung
– Einzelne unterstützen, die sich ausgegrenzt fühlen oder untergehen.
– den Gruppenprozess spiegeln, mit der Frage: “Was passiert hier gerade mit uns?”
Die Leitung ist nun mehr denn je Prozessbegleiter*in. Es braucht Mut, Spannungen zuzulassen und ihnen Raum zu geben – aber genau darin liegt der Schlüssel für nachhaltige Gruppenentwicklung.
Praxistipps für die Storming-Phase
Die folgenden praktischen Maßnahmen haben sich in der Gruppenarbeit bewährt die Storming-Phase aktiv zu begleiten:
Gruppenregeln gemeinsam reflektieren
Regeln, die in der Orientierungsphase “von oben” gegeben wurden, werden jetzt gemeinsam überprüft: Was funktioniert für uns? Was nicht? Welche Konsequenzen sollen bei Regelverstößen gelten? Ein transparenter Umgang mit den Regeln sorgt für Verbindlichkeit.
Gruppenklima beobachten
Die Stimmung in der Gruppe ist ein wichtiger Indikator. Wer sich regelmäßig Zeit für Reflexion nimmt – zum Beispiel am Ende einer Einheit mit einem anonymen Feedback – erkennt Spannungen früh.
Rollenkonflikte sichtbar machen
Rollenspiele, Gruppenarbeiten oder einfache Feedbackübungen (“Ich sehe dich in der Gruppe als…”) helfen dabei, Rollen zu benennen, zu überprüfen und ggf. zu verändern. Wichtig ist: Rollenzuschreibungen sollten nie fixiert werden.
Konflikttrainings oder Gesprächsrunden anbieten
Bei älteren Jugendlichen ist es sinnvoll, Kommunikationsregeln, gewaltfreie Sprache oder konstruktive Kritik methodisch zu üben. Das können kurze Übungen, Moderationsmethoden oder ganze Workshops sein.
Phase 3: Norming – Wir-Gefühl und Regeln festigen
In der dritten Gruppenphase, dem Norming, stabilisiert sich der zuvor oft konflikthafte Gruppenprozess: Aus Einzelpersonen wird eine Gemeinschaft mit gemeinsamen Regeln, Zielen und einem wachsenden Wir-Gefühl. Rollen und Routinen festigen sich, Konflikte nehmen ab. Für Leitungen eröffnet diese Phase neue Optionen für Partizipation und Zusammenarbeit – vorausgesetzt, die vorherigen Phasen wurden bewusst begleitet.
Typische Merkmale der Norming-Phase
In der Norming-Phase zeigen sich deutliche Veränderungen im Gruppenverhalten. Viele Spannungen aus der Storming-Phase lösen sich auf oder werden produktiv bearbeitet. Gleichzeitig wächst der Wunsch, zur Gemeinschaft beizutragen. Es entstehen gemeinsame Werte und Strukturen, die von der Gruppe getragen und nicht mehr nur von außen vorgegeben werden.
Typische Kennzeichen dieser Phase sind:
– wachsendes Wir-Gefühl
– akzeptierte Gruppenregeln
– verlässliche Rollenverteilung
– produktive Zusammenarbeit
– konstruktiver Umgang mit Konflikten
– offene Kommunikation
– gemeinsame Rituale
Diese Phase ist nicht konfliktfrei – aber sie ist konfliktfähig. Der Umgang mit Herausforderungen wird reflektierter, respektvoller und lösungsorientierter.
Was Gruppen jetzt brauchen
Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen verändern sich mit dem Fortschreiten des Gruppenprozesses. In der Norming-Phase stehen nun andere Aspekte im Vordergrund als in den vorherigen Phasen:
– Mitbestimmung
– Wertschätzung
– Verlässlichkeit
– Raum für Selbstwirksamkeit
– Verbindung
Leitung ist in dieser Phase weniger durch Kontrolle, sondern durch Rahmensetzung, Ermöglichung und Begleitung gefragt.
Die Rolle der Leitung im Norming: Verantwortung teilen
Jugendleiter*innen nehmen in der Norming-Phase eine zunehmend moderierende Rolle ein. Die Gruppe ist in der Lage, Aufgaben selbstständig zu bewältigen und Entscheidungen im Konsens zu treffen – sofern die entsprechenden Strukturen vorhanden sind.
Zentrale Aufgaben in dieser Phase sind:
– Partizipation unterstützen
– Verlässlichkeit sichern
– Stärken fördern
– Beziehungen pflegen
– Veränderung begleiten
Der Übergang zur Norming-Phase ist häufig fließend. Es lohnt sich, diesen Wandel aktiv zu thematisieren – zum Beispiel in Reflexionsrunden oder durch symbolische “Übergänge” (z. B. durch das gemeinsame Festlegen neuer Gruppenregeln).
Praxistipps für die Norming-Phase
Die Norming-Phase liefert Optionen, die Gruppenentwicklung aktiv zu gestalten. Folgende Methoden und Impulse sind nun in der Jugendarbeit sinnvoll:
Gruppenregeln gemeinsam überarbeiten
Was in der Anfangszeit noch “gesetzt” wurde, kann jetzt reflektiert und angepasst werden. Die Gruppe sollte sich ihre Regeln bewusst aneignen – vielleicht sogar visualisieren (Plakat, Symbolkarten, Collage).
Verantwortung in Rollen übertragen
Rollen wie “Zeitwächter*in”, “Materialverantwortliche*r” oder “Gruppensprecher*in” sorgen für Verantwortungsbewusstsein. Wichtig: Aufgaben sollten wechselbar und freiwillig sein.
Projektarbeit unterstützen
Die Gruppe ist jetzt arbeitsfähig. Gemeinsame Projekte – von einem Gruppenraum gestalten über ein Video drehen bis hin zu einem sozialen Engagement – stärken das Wir-Gefühl.
Phase 4: Performing – Zusammenarbeit & Dynamik nutzen
In der Performing-Phase erreicht die Gruppe ihren Höhepunkt: Sie arbeitet eigenständig, produktiv und mit starkem Zusammenhalt. Die Leitung kann sich zurücknehmen, Freiräume schaffen und Impulse setzen, sollte jedoch weiterhin Gruppenprozesse und Beziehungen im Blick behalten. Diese Phase ist das Ergebnis bewusster Beziehungsarbeit und klarer Kommunikation.
Kennzeichen der Performing-Phase
Die Performing-Phase ist gekennzeichnet durch eine starke innere Struktur, eine produktive Atmosphäre und ein hohes Maß an Selbstorganisation. Die Gruppe hat sich gefunden, Rollen sind geklärt, Normen etabliert und Vertrauen gewachsen. Nun ist die Gruppe in der Lage, zielgerichtet zu arbeiten, kreativ zu lösen und eigenverantwortlich zu handeln.
Typische Merkmale dieser Phase:
– hohe Motivation und Identifikation mit der Gruppe
– Produktive Aufgabenorientierung und Fokus auf gemeinsame Ziele
– flexibler Umgang mit Rollen je nach Situation und Kompetenz
– Selbstorganisierte Zusammenarbeit, weniger Leitungskontrolle nötig
– offene, reflektierte Kommunikation über Inhalte und Prozesse
– gegenseitige Unterstützung und Vertrauen
– konstruktiver Umgang mit Kritik und Konflikten
Nicht alle Gruppen erreichen diese Phase. Sie setzt voraus, dass die vorherigen Phasen durchlaufen und reflektiert wurden. Wo Storming unterdrückt oder Norming übersprungen wurde, fehlt die Basis für echtes Performing.
Was Gruppen jetzt brauchen
Die Bedürfnisse der Gruppe in der Performing-Phase unterscheiden sich deutlich von früheren Entwicklungsphasen. Während früher Sicherheit, Struktur und Orientierung im Vordergrund standen, wünschen sich Gruppen nun:
– Eigenverantwortung
– Anerkennung
– Projekte und Aufgaben, die fordern und motivieren
– Zeit, Raum, Material und Unterstützung für ihre Ideen
– Rahmenbedingungen, die Entwicklung fördern
Jugendleiter*innen sollten sich in dieser Phase nicht zurückziehen, aber gezielt loslassen. Das bedeutet: weniger Kontrolle, mehr Vertrauen. Leitung wird zur beratenden, unterstützenden, inspirierenden Kraft.
Die Rolle der Leitung: Impulse, Begleitung, Freiraum
In der Performing-Phase ändert sich die Leitungsrolle grundlegend. Sie besteht nicht mehr vorrangig in Steuerung. Leitung heißt jetzt:
– Prozesse beobachten, statt sie zu dominieren
– Impulse geben, ohne zu übernehmen
– Verantwortung übertragen und Entscheidungen delegieren
– Anerkennung zeigen und Erfolge sichtbar machen
– Selbstreflexion anregen und gruppendynamische Entwicklungen thematisieren
Die größte Kunst besteht darin, im richtigen Moment einzuschreiten – wenn Prozesse festfahren, Einzelne untergehen oder neue Dynamiken entstehen, die den Gruppenerfolg gefährden.
Praxistipps für die Performing-Phase
Projektorientiertes Arbeiten unterstützen
Gruppen, die sich in der Performing-Phase befinden, profitieren von komplexen, offenen Aufgaben: Ob ein eigener Film, eine Theaterproduktion, ein Benefizlauf oder ein soziales Projekt – wichtig ist, dass die Gruppe von der Idee bis zur Umsetzung selbstbestimmt arbeitet.
Rollen flexibel gestalten
Erlaubt sein sollte, dass Rollen je nach Aufgabe wechseln. Heute übernimmt eine Person die Moderation, morgen die Technik, übermorgen das Feedback.
Reflexionsroutinen einbauen
Ob wöchentlicher Check-in, Projekt-Tagebuch oder kreative Feedbackmethoden: Regelmäßige Reflexion fördert Transparenz, verbessert Zusammenarbeit und gibt Raum für Entwicklung.
Fehler als Lernchancen nutzen
In der Performing-Phase darf ausprobiert, experimentiert und auch mal gescheitert werden. Eine offene Fehlerkultur, die von der Leitung mitgetragen wird, schafft Innovationskraft.
Erfolge sichtbar machen
Gemeinsame Erfolge zu feiern, schafft Stolz und Zusammenhalt. Ob mit Urkunden, einem Projektbericht, einer kleinen Ausstellung oder einem Fest – gemeinsam Rückblick zu halten, lohnt sich.
Phase 5: Adjourning – Abschied und Übergänge gestalten
In der fünften Phase, dem Adjourning, endet die Gruppenarbeit – ein emotional bedeutsamer Prozess für alle Beteiligten. Abschied ist mehr als Organisation, er prägt die Erinnerung an die gemeinsame Zeit. Für Jugendleiter*innen ist es wichtig, diesen Abschluss bewusst zu gestalten, da er pädagogisch wertvoll ist und das Erlebte positiv abrundet.
Kennzeichen der Adjourning-Phase
Die letzte Phase ist geprägt von Loslösung, Rückblick und Übergang. Die Gruppe erkennt, dass ihre gemeinsame Zeit endet. Dies kann offen ausgesprochen oder schleichend spürbar werden. Häufige Merkmale dieser Phase sind:
– emotionale Reaktionen
– Rückblick und Reflexion
– Auflösung von Rollen
– Suche nach Orientierung
Die Adjourning-Phase kann sowohl geordnet als auch abrupt erfolgen. Im pädagogischen Kontext lohnt es sich, den Abschied strukturierend, emotional achtsam und reflektiert zu gestalten.
Was Gruppen jetzt brauchen
In dieser Phase stehen die emotionalen und sozialen Aspekte des Gruppenprozesses im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden benötigen:
– Räume zur Reflexion
– Anerkennung
– gestalteter Abschied
– Perspektiven
– Begleitung im Übergang
Ein bewusst gestalteter Gruppenabschluss schützt vor dem Eindruck, das gemeinsame Erlebte sei bedeutungslos oder beliebig.
Die Rolle der Leitung: strukturieren, würdigen, loslassen
Jugendleiter*innen tragen in der Adjourning-Phase eine besondere Verantwortung. Ihre Aufgabe ist es, den Übergang klar, empathisch und wertschätzend zu begleiten. Das bedeutet:
– frühzeitig über das bevorstehende Ende informieren
– Reflexion anregen
– Anerkennung geben
– Rituale gestalten
– Raum für Emotionen zulassen
– Abschiede differenziert gestalten
Die Leitung sollte sich bewusst machen, dass diese Phase pädagogisch genauso relevant ist wie der Anfang. Sie ist nicht “nur” ein organisatorischer Schlusspunkt, sondern ein zentraler Moment der Beziehungsgestaltung.
Praxistipps für die Adjourning-Phase
Abschlussrituale entwickeln
Ob ein gemeinsames Lagerfeuer, eine Präsentation, ein Gruppenfoto oder das Packen einer Erinnerungsbox – Rituale helfen, das Ende sichtbar und emotional greifbar zu machen. Sie geben Struktur, Halt und Bedeutung.
Feedbackrunden durchführen
Reflexionsmethoden wie “Was nehme ich mit?”, “Was war mein Highlight?”, “Was hätte ich mir anders gewünscht?” schaffen Raum für individuelle Bilanz und gegenseitige Wertschätzung. Dabei sollte der Fokus auf dem gemeinsamen Lernprozess liegen, nicht auf Bewertung.
Briefe schreiben lassen
Ein Brief an das eigene Ich (“Was habe ich gelernt?”), an andere Gruppenmitglieder (“Das möchte ich dir sagen”) oder an die Gruppe insgesamt (“Das war unsere Zeit”) unterstützt tiefe Reflexion – gerade auch für introvertierte Teilnehmende.
Erinnerungen sichern
Eine Fotoausstellung, ein Video oder ein gemeinsames Tagebuch lassen die gemeinsame Zeit greifbar werden. Sie sind auch über das Gruppenende hinaus verbindend.
Ausblick geben
Werden sich manche wiedersehen? Gibt es Folgetreffen, Anschlussgruppen oder digitale Wege, in Kontakt zu bleiben? Orientierung hilft, den Übergang besser zu gestalten.