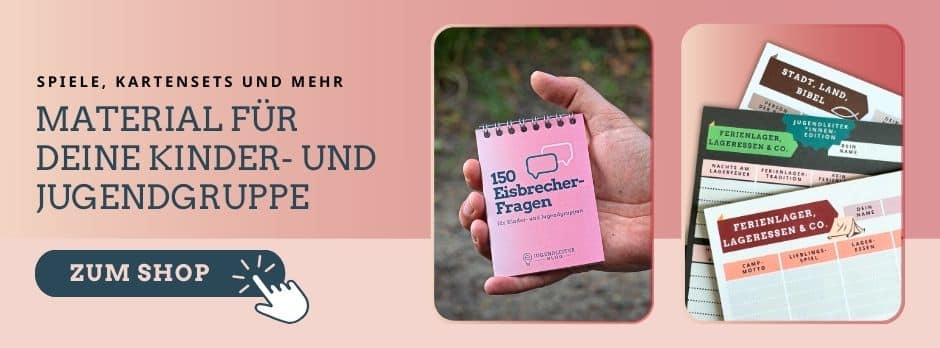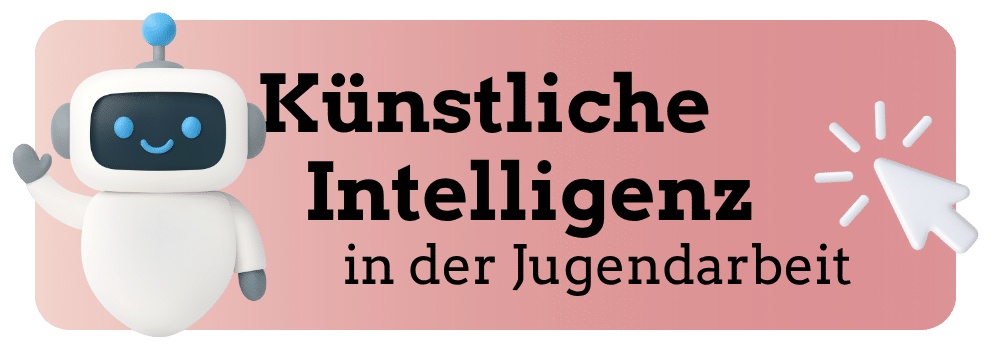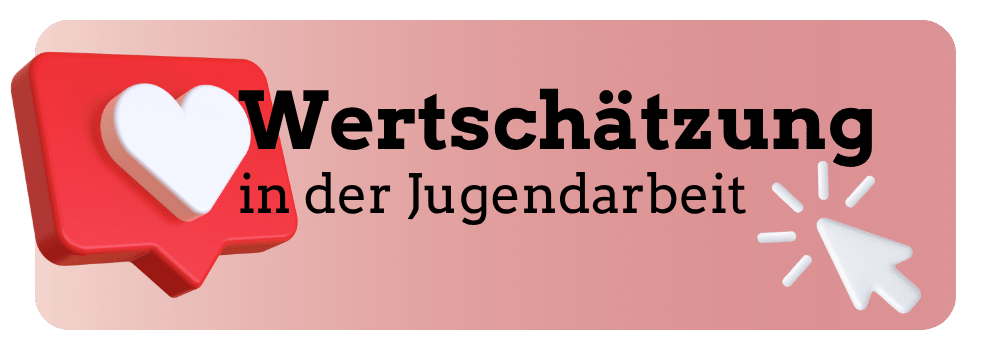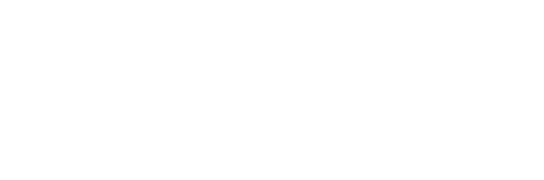Als Jugendleiter*innen leistet ihr einen beträchtlichen Beitrag zur Betreuung von Kindern und kommt im Rahmen verschiedener Jugendprogramme in engen Kontakt mit ihnen. Ihr seid also ganz nah am Geschehen und bekommt es so schnell mit, wenn sich ein Kind respektlos oder auf andere Weise unangemessen verhält. Nicht selten kann das ein Hinweis darauf sein, dass es zu Hause Spannungen gibt und die Kinder vielleicht sogar gar nicht mit ihren Eltern klarkommen. Im Folgenden gehen wir darauf ein, wie ihr als Jugendleiter*innen Verhaltensstörungen erkennen könnt, wie diese entstehen und in welchen Fällen das Jugendamt eingeschaltet werden sollte.
Wie entstehen Verhaltensstörungen bei Kindern?
Verhaltensstörungen bei Kindern zeigen sich häufig durch eine fehlende Impulskontrolle und aggressives und respektloses Verhalten. Manche von ihnen werden sogar richtig gewalttätig, was auch für die anderen Kinder zu einer Gefahr werden kann. Solche Verhaltensstörungen werden durch verschiedene Einflussfaktoren wie die Genetik und das soziale Umfeld begünstigt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Erziehung der Eltern und ob sie ihrem Kind ausreichend Aufmerksamkeit schenken. Wenn sie nur wenig Interesse an ihrem Kind zeigen, selbst gewalttätig sind oder unter dauerhaftem Stress leiden, kann sich das deutlich im Verhalten des Kindes widerspiegeln.
Wie erkennt man eine Verhaltensstörung bei Kindern?
Verhaltensstörungen bei Kindern können sich auf verschiedene Arten zeigen, weisen aber in der Regel typische Symptome auf:
- Schlechte Impulskontrolle: Das Kind hat eine kurze Zündschnur und flippt regelmäßig aus? Selbst Kleinigkeiten bringen es schon auf die Palme? Das ist ein deutliches Zeichen für eine beeinträchtigte Impulskontrolle.
- Mangelhafte Problemlösefähigkeit: Kinder mit Störungen des sozialen Verhaltens sind oft nicht in der Lage, Konflikte zu lösen, sich mit anderen wieder zu versöhnen oder sich nach einer Streiterei zu entschuldigen.
- Fehlende Empathie: Wenn ein Kind nie Mitgefühl mit anderen hat oder über deren Missgeschicke und Probleme sogar lacht, anstatt Anteilnahme zu zeigen, kann das viele Ursachen haben. Dazu gehören unter anderem die fehlende Vorbildfunktion der Eltern und erlebte Traumata.
- Ständige Apathie: Das Kind scheint immer irgendwie abwesend zu sein und kann sich für nichts begeistern. Der Grund dafür kann eine chronische Übermüdung sein. Vielleicht ist das Kind aber auch unterernährt oder leidet an einer psychischen Störung.
Als Jugendleiter*innen solltet ihr aufmerksam werden, wenn ihr dieses Verhalten bei Kindern beobachtet und das Gespräch mit den Eltern suchen. Nicht immer sind diese jedoch der Auslöser. Bisweilen können auch andere Faktoren wie Gewalt und Mobbing zwischen Gleichaltrigen und eine daraus resultierende Außenseiterrolle Verhaltensstörungen begünstigen. Auch Social Media und der damit verbundene Druck spielen gegebenenfalls eine Rolle, sodass immer das große Ganze betrachtet werden soll. Gemeinsam mit den Eltern habt ihr aber ja vielleicht die Möglichkeit, den Ursachen auf die Spur zu kommen. Es kann jedoch auch passieren, dass sich durch das Gespräch mit den Erziehungsberechtigten der Verdacht erhärtet, dass das Kind in einem ungünstigen Umfeld aufwächst.
Wann sollte man das Jugendamt kontaktieren?
Dass ihr euch als Jugendleiter*innen schnell Sorgen macht, wenn ein Kind aus der Reihe fällt, ist ganz natürlich. Schließlich handelt es sich um Schutzbedürftige, die sich in eurer Obhut befinden und nicht immer lassen sich Probleme mit einem Elterngespräch lösen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ein Kind schwerwiegende Probleme zu Hause hat und möglicherweise eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, solltet ihr nicht zögern und das Jugendamt informieren. Damit zerstört man keine Familien, sondern gibt erst einmal dem Jugendamt die Möglichkeit, den Fall zu prüfen und individuell zu bewerten, ob die Vorwürfe haltbar sind und ob Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen.
Wie sollten Jugendleiter*innen bei einem Verdacht der Kindeswohlgefährdung vorgehen?
Jugendleiter*innen, die bei einem ihrer Schützlinge Verhaltensauffälligkeiten feststellen, sollten das betreffende Kind besonders gut beobachten und entsprechende Vorfälle akribisch dokumentieren. Neben dem Vorfall an sich solltet ihr auch das Datum und die Uhrzeit unbedingt festhalten. Bei einem konkreten Verdacht, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, sollte das Jugendamt so schnell wie möglich informiert werden. Wie bereits erwähnt, führt das nicht unmittelbar dazu, dass die Kinder aus der Familie geholt werden. Das Jugendamt kann der Familie je nach Fall auch mit Beratungsangeboten zur Seite stehen und so ohne Kindesentzug dabei helfen, dass sich die Situation bessert.
Was sind Anzeichen für eine Kindeswohlgefährdung?
Die Anzeichen für eine Kindeswohlgefährdung sind so vielfältig, dass wir sie hier nicht alle aufzählen können. Die Alarmglocken sollten aber schrillen, wenn das Kind deutliche körperliche Anzeichen wie ständige Hämatome an ungewöhnlichen Stellen, Untergewicht, ein ungepflegtes Erscheinungsbild, Knochenbrüche oder selbstverletzendes Verhalten aufweist. Auch Verhaltensstörungen sowie Essstörungen und ständige Angst oder kognitive Auffälligkeiten in Form von Sprachstörungen und Wahrnehmungsstörungen sind deutliche Warnsignale, die nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollten.
Welche Aufgabe hat das Jugendamt?
Das Jugendamt hat einen Schutzauftrag, der in § 8a des SGB VIII verankert ist. Wenn ein Jugendleiter oder eine Jugendleiterin meldet, dass er sich Sorgen um ein Kind macht, muss es also entsprechend reagieren und sich um die Sache kümmern. Es bewertet jetzt, ob eine Gefährdung vorliegt und wie schwer diese ist. Bei einem dringenden Verdacht wird es außerdem das Familiengericht beauftragen, sodass durch einen richterlichen Beschluss schnell gehandelt werden kann. Das Jugendamt ist also zur Klärung des Sachverhalts verpflichtet.