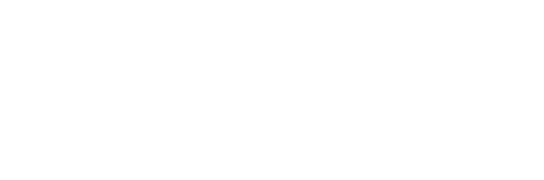2. Psychologische Grundlagen: Ängste, Trauma & Resilienz stärken
Wenn Kinder und Jugendliche mit Nachrichten von Krieg, Gewalt, Naturkatastrophen oder anderen Krisen konfrontiert werden, rufen diese Erlebnisse starke emotionale Reaktionen hervor. Angst, Unsicherheit, Hilflosigkeit und Wut sind ganz normale Reaktionen. In diesem Modul geht es darum zu verstehen, wie solche Reaktionen entstehen, was hinter ihnen steckt und wie Jugendleiter*innen dabei helfen, mit ihnen umzugehen. Im Mittelpunkt steht die Stärkung der seelischen Widerstandskraft – der Resilienz.
___STEADY_PAYWALL___
Was ist Angst und wie äußert sie sich bei Kindern und Jugendlichen?
Angst ist ein grundlegendes menschliches Gefühl. Sie dient dem Schutz und ist eine Reaktion auf eine wahrgenommene Bedrohung. Bei Kindern und Jugendlichen drückt sich Angst auf vielfältige Weise aus – nicht immer direkt und nicht immer eindeutig.
Kleinere Kinder zeigen Angst häufig durch körperliche Symptome oder verändertes Verhalten: Sie schlafen schlecht, klammern sich an Bezugspersonen, fürchten sich vor dem Alleinsein oder reagieren mit Weinen, Bauchschmerzen oder Wut. Bei älteren Kindern und Jugendlichen ist die Angst komplexer: Sie kann sich in sozialem Rückzug, schulischer Leistungsverweigerung, Konzentrationsproblemen oder übertriebenem Medienkonsum äußern. Manche versuchen, ihre Angst mit “Coolness” zu überspielen, andere geraten in eine Spirale aus Katastrophenfantasien und Panik.
Entscheidend ist: Angst ist nicht per se negativ. Sie ist ein Signal des Körpers, dass etwas nicht stimmt – und verdient Aufmerksamkeit, nicht Abwertung. Jugendleiter*innen sollten deshalb genau beobachten und zuhören, ohne zu werten oder vorschnelle Schlüsse zu ziehen.
Der Unterschied zwischen Angst und Trauma
Nicht jede Angst führt zu einem Trauma. Aber manche Erlebnisse hinterlassen so starke Spuren, dass sie das seelische Gleichgewicht nachhaltig stören. Ein Trauma ist eine seelische Verletzung, die entsteht, wenn ein Mensch ein Ereignis als existenziell bedrohlich erlebt und keinen Weg zur Verarbeitung findet.
Bei Kindern und Jugendlichen ist die Abgrenzung nicht immer einfach, denn sie ordnen Erlebnisse noch nicht so differenziert ein wie Erwachsene. Ein Krieg in einem fernen Land wird für ein Kind genauso traumatisch erlebt wie ein ganz reales Erlebnis im eigenen Umfeld – etwa ein Autounfall oder die plötzliche Trennung der Eltern. Entscheidend ist nicht die “objektive Schwere” des Ereignisses, sondern wie bedrohlich es subjektiv empfunden wurde.
Typische Anzeichen für eine traumatische Reaktion sind:
– Wiederkehrende Erinnerungen oder Albträume
– Vermeidung von allem, was an das Ereignis erinnert
– Schlafprobleme, Schreckhaftigkeit, Konzentrationsstörungen
– Reizbarkeit, plötzliche Aggressionen oder starke Rückzugsreaktionen
Wichtig: Jugendleiter*innen müssen, können und dürfen keine Diagnose stellen. Aber sie sollten sensibilisiert sein und bei Verdacht professionelle Hilfe hinzuziehen und/oder empfehlen. Die Aufgabe in der Jugendarbeit besteht nicht darin, ein Trauma zu therapieren, sondern Raum zu geben, zuzuhören, Sicherheit zu vermitteln und Grenzen zu respektieren.
Resilienz – die seelische Widerstandskraft stärken
Der Begriff Resilienz beschreibt die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Manche Kinder und Jugendliche entwickeln trotz schwieriger Umstände erstaunliche innere Stabilität – sie haben eine hohe Resilienz. Diese Fähigkeit ist nicht angeboren.
Was macht Kinder und Jugendliche resilient? Forschung und Praxis zeigen: Es sind nicht einzelne Eigenschaften, sondern eine Kombination aus inneren und äußeren Faktoren, die Resilienz begünstigen. Dazu zählen:
– Stabile Beziehungen zu Erwachsenen, die Sicherheit, Verständnis und Zuversicht vermitteln
– Selbstwirksamkeit: das Gefühl, selbst etwas zu bewirke
– Problemlösekompetenz und kreative Bewältigungsstrategien
– Emotionales Verstehen: Gefühle wahrnehmen, benennen und ausdrücken
– Sinn- und Werteorientierung, die Halt gibt
In der Jugendarbeit findet Resilienzförderung auf viele Weise statt – nicht durch Programme, sondern im ganz normalen Alltag:
– Jugendliche in Entscheidungen einbeziehen und ihnen Verantwortung übertragen
– Einen sicheren Rahmen garantieren, in dem sie sich ausprobieren
– Gespräche über Gefühle zulassen und aktiv anregen
– Erfolge sichtbar machen und Ressourcen in den Fokus rücken
– Werte wie Zusammenhalt, Vertrauen und Achtsamkeit leben
Der Umgang mit Ängsten im Gruppenkontext
Gruppensituationen versprechen Chancen – und Risiken. Einerseits erleben Kinder und Jugendliche hier Gemeinschaft, Entlastung und Normalität. Andererseits verstärken Gruppendruck, Vergleiche oder verletzende Kommentare Ängste noch zusätzlich.
Jugendleiter*innen sollten deshalb eine Kultur der Offenheit und gegenseitigen Achtung einführen. Dazu gehören Regeln für Gespräche ebenso wie das aktive Vorleben von Empathie und Respekt. Ängste dürfen ausgesprochen werden, ohne dass jemand sich schämen oder rechtfertigen muss. Die Gruppe wird zu einem Schutzraum, wenn sie getragen ist von Vertrauen und Zugehörigkeit.
Die Rolle der Jugendleiter*in: Da sein, ohne zu überfordern
Jugendleiter*innen müssen keine psychologischen Fachkräfte sein. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, präsent zu sein, zuzuhören, Orientierung zu geben und im Zweifel weiterzuvermitteln. Das bedeutet auch: die eigenen Grenzen kennen und achten.
Es ist in Ordnung, keine Antwort auf alles zu haben. Es ist erlaubt zu sagen: “Das weiß ich gerade auch nicht, aber ich bin da.” Oft hilft allein das Gefühl: Ich bin nicht allein mit meinen Sorgen.
Jugendleiter*innen sind keine Therapeut*innen. Aber sie sind Bindungspersonen im Leben vieler junger Menschen. Diese Rolle zu verstehen und mit Klarheit, Empathie und Verantwortung auszufüllen, ist ein zentraler Baustein für psychische Gesundheit in Krisenzeiten.
Checkliste
Angst verstehen und ernst nehmen:
– Kinder äußern Angst oft indirekt (über Bauchschmerzen, Schlafprobleme, Rückzug)
– Jugendliche überspielen Angst mit Coolness oder ziehen sich zurück
Trauma erkennen (Verdachtsmomente):
– Albträume, Flashbacks, starke Vermeidung bestimmter Themen
– Plötzliche Wesensveränderung, Reizbarkeit, extreme Rückzugsreaktionen
Resilienz fördern im Alltag:
– Stabile Beziehungen anbieten
– Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen
– Gefühle zulassen und benennen
– Raum für Mitbestimmung schaffen
– Gruppenklima durch Wertschätzung und Vertrauen stärken
Eigene Rolle reflektieren:
– Nicht überfordern – präsent sein reicht oft aus
– Bei Unsicherheiten professionelle Hilfe einbeziehen