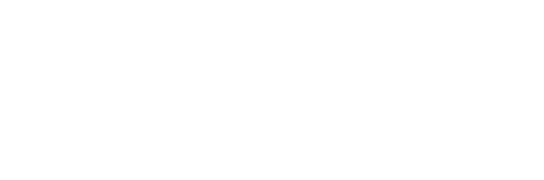Die 9 Partizipationsstufen
Dazu gibt es übrigens ein Stufenmodell, welches von Roger Hart (1992) und Wolfgang Gernert (1993) entwickelt wurde, um das Wort “Partizipation” als “Stufen der Beteiligung” widerzuspiegeln.
___STEADY_PAYWALL___
1. Fremdbestimmt: Ziele und Projekte sind den Kindern und Jugendlichen nicht klar. Dadurch werden sie manipuliert und verstehen die Hintergründe nicht.
2. Dekoration: Die Teilnehmer*innen wirken zwar bei einem Projekt mit, wissen jedoch nicht, warum sie eigentlich mitmachen. Der Sinn zum Zweck ist nicht klar.
3. Alibi-Teilnahme: Hierbei nehmen die Beteiligten zwar an Konferenzen teil, können jedoch selbst darüber entscheiden, ob sie das Angebot annehmen, ihre Stimme zur Geltung zu machen.
4. Teilhabe: Die Teilnehmer*innen zeigen bei einem Projekt sporadischen Einsatz.
5. Zugewiesen, aber informiert: Ein Projekt wird von erwachsenen Personen vorbereitet, die Kinder und Jugendlichen wissen aber worum es geht und haben sich auch gut dazu informiert, um sich einbringen zu können.
6. Mitwirkung: Fragebögen, Tests und Interview werden zwar für ein Stimmungsbild der Kinder und Jugendlichen benutzt, allerdings haben sie keine Entscheidungskraft.
7. Mitbestimmung: Dabei werden die Teilnehmenden aktiv mit einbezogen. Die Entscheidung wird dann gemeinsam mit den Erwachsenen demokratisch gefällt.
8. Selbstbestimmung: Kinder und Jugendliche zeigen nun Engagement, indem sie selbst ein Projekt auf die Beine stellen. Dabei werden sie nur von Erwachsenen unterstützt und ggf. gefördert. Hier entscheiden die Kinder, die Erwachsenen tragen lediglich die Entscheidung gemeinsam mit den jungen Menschen.
9. Selbstverwaltung: Das ist die höchste Stufe, dabei haben die Kinder und Jugendlichen eine totale Entscheidungsfreiheit. Angebote werden geplant und umgesetzt und lediglich die Entscheidungen werden den Erwachsenen mitgeteilt.
Was ihr immer bedenken solltet und euch vielleicht sogar als kleinen Leitsatz abspeichern solltet, ist, dass Kinder und Jugendliche in ihrer eigenen Sache immer die Experten und Expertinnen sein werden. Auch vom bürgerlichen Gesetzbuch her handelt es sich bei jungen Menschen um “Subjekte, die ihre Rechte eigenständig ausüben können” und auch dürfen sollten.
Sogar im Gesetzestext (Ausz. 3.AG KJHG NRW) ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im § 6 niedergeschrieben.
Hier heißt es unter anderem, dass die Träger in der öffentlichen Jugendarbeit dafür zu sorgen haben, dass die Teilnehmer*innen entsprechend ihres Entwicklungsstandes über die sie betreffenden Dinge informiert werden müssen. Außerdem sollen sie dazu noch auf ihre Rechte hingewiesen werden, also beispielsweise ihr Mitbestimmungsrecht. In dieser Sache sollen dann Ansprechpartner zur Verfügung stehen, welche eben dazu dienen, dass ihre Wahrnehmung in Sachen “Rechte” gefördert und sensibilisiert wird.
Auch die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen wir hier aufgeführt. Dabei werden viele Lebensbereiche aufgeführt, in denen die jungen Menschen einbezogen werden solltet. Dazu gehören beispielsweise die Planungen, Entscheidungen und Maßnahmen von Spielflächen, des Wohnumfelds und die bauliche Gestaltung von öffentlichen Einrichtungen. Natürlich alles altersgerecht und angemessen gestaltet.
Des Weiteren heißt es hier, dass das Land die betreffenden Kinder und Jugendlichen (beispielsweise in der Gestaltung des Kinder- und Jugendförderplans) anhören soll, zumindest “im Rahmen des Möglichen”.
Am Ende heißt es dann noch, dass die öffentlichen Träger das besondere Belangen der Kinder und Jugendlichen zum Thema “Gestaltung der Angebote” berücksichtigen sollen. Dabei steht das “Mitspracherecht” im Vordergrund.
Ins Leben gerufen wurde die oben genannte Gesetzesgrundlage übrigens am 12.10.2004. Diese wurde speziell für die Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ins Leben gerufen, eben mit dem Hintergrundgedanken, jungen Menschen ein möglichst selbst bestimmtes Leben zu ermöglichen.